Heidelberger Universitätsprofessor hinterfragt die Gesundheitsdiktatur der modernen Medizin und plädiert für eine menschenzugewandte individualisierte Medizin.
 Man stelle sich vor, man hätte die Möglichkeit, „auf einem Bierdeckel“ die wichtigsten Wünsche an einen Allgemeinarzt oder Internisten festzuhalten.
Man stelle sich vor, man hätte die Möglichkeit, „auf einem Bierdeckel“ die wichtigsten Wünsche an einen Allgemeinarzt oder Internisten festzuhalten.
Würde man dann tatsächlich schreiben, man wünscht sich, dass der Arzt immer die neuesten Medikamente zur Verfügung hat und von der Pharmaindustrie regelmäßig beraten wird?
Würde man schreiben, man wünscht sich, dass die durch sogenannte epidemiologische Kohortenstudien bekannten Assoziationen und Korrelationen zwischen sog. Risikofaktoren und Krankheiten bei der Therapie berücksichtigt werden?
Würde man auf dem Bierdeckel festhalten, dass es essentiell und therapieentscheidend ist, durch Laborwerte sog. Risikofaktoren frühzeitig zu identifizieren?
Oder würde man schreiben, dass man gerne zu einem Arzt geht, der alles weiß, und dessen Wissen keine Lücken hat?
Statt dieser Vorstellung werden jetzt im Folgenden drei ganz anders formulierte Zielvorgaben für einen optimal nachdenkenden und handelnden Arzt formuliert:
1. Der Arzt muss primär Menschen mögen, den singulären Patienten, der vor ihm sitzt, achten und ihn als ein Individuum betrachten.
Ich spreche in meinem Buch von Gesundheitsdiktatur, weil genau hier ein großes Problem der modernen Medizin liegt.
Beispiel Gewicht und Gesundheit
Epidemiologische Studien, oft an Tausenden von Menschen durchgeführt, zeigen z.B., dass es einen statistisch sicheren Bezug zwischen Gewicht und Herzinfarkt oder Schlaganfall oder Krebs gibt. Doch wenn ich das Schicksal des Einzelnen berücksichtige, der vor mir sitzt, muss ich als Arzt mich fragen: Darf ich dem einen Patienten, der vor mir sitzt, raten, Gewicht abzunehmen, nur weil es Studien gibt, die einen statistischen Bezug gezeigt haben?
Die Antwort ist ganz eindeutig, dass dies unethisch ist, denn wenn ich jemandem rate, Gewicht abzunehmen, Sport zu treiben, oder eine Diät einzuhalten, so gibt es sehr gute Untersuchungen, die belegen, dass dies die Lebensqualität reduziert. Ich darf das Leiden des Patienten durch eine Diät, durch Sport oder eine sonstige ärztliche Intervention nur dann vertreten, wenn gesichert ist, dass diese Intervention auch tatsächlich dem Patienten etwas nutzt.
Beim Thema Gewicht gilt nun, dass es bis heute keine einzige Studie gibt, die belegt, dass tatsächlich Gewichtsreduktion Herzinfarkt oder Schlaganfall oder Krebs reduzierten kann, mithin es ethisch nicht gerechtfertigt ist, basierend auf solchen epidemiologischen Studien, eine Therapie zu empfehlen, die in die Privatsphäre und die Lebensgestaltung eines einzelnen Menschen eingreift. Sobald es Studien gibt, die dies belegen, wäre dies tatsächlich dann etwas Anderes, aber sie gibt es nicht.
Beispiel Sport und Gesundheit
Ähnlich verhält es sich mit Sport. Eine kürzlich publizierte Studie belegte eindeutig, dass auch nach vielen Jahren, auch in einer sehr großen Gruppe von Patienten mit Typ-2-Diabetes, Sport zwar die körperliche Fitness verbessert und das Gewicht reduziert. Aber auch nach Jahren war kein Effekt auf Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod feststellbar. Deshalb wurde in den USA diese Studie aus ethischen Gründen abgebrochen. Auch beim Sport ergibt sich daher eine verblüffende Diskrepanz zwischen ärztlichem Rat, typischerweise basierend auf Beobachtungsstudien, und ganz anderen Ergebnissen, die die Interventionsstudien erbringen.
Da aber alles das, was wir unseren Patienten raten, letztlich eine Intervention ist, sind wir Ärzte gehalten, auf Interventionsstudien und nicht auf Beobachtungsstudien unsere Entscheidungen fußen zu lassen. Es gibt keine einzige Intervention, die harmlos ist, die nebenwirkungsfrei ist, so dass immer die wissenschaftlich belegte Wirksamkeit an erster Stelle zu stehen hat.
Kritik an den üblichen Arzneimittelstudien
Hier ergibt sich auch eine fundamentale Kritik an den üblicherweise publizierten Arzneimittelstudien, selbst in den besten Zeitschriften der Welt.
Relatives Risiko
Wir haben uns inzwischen daran gewöhnt, mit dem sog. relativen Risiko zu rechnen. Das heißt, wenn ohne Therapie 100 Patienten einen Herzinfarkt bekommen, mit Therapie nur 50, so nennen wir das eine 50%ige Reduktion des Risikos, verschweigen dabei aber, dass es nur das relative Risiko ist.
Absolutes Risiko
Das absolute Risiko errechnet sich aus der Gesamtzahl der Patienten, die behandelt werden. Wenn aber nur 10% der Patienten ein Ereignis ohne Therapie bekommen, mit Therapie nur 5% der Patienten, ist dies zwar eine relative Risikoreduktion von 50%, jedoch eine absolute Risikoreduktion nur um 5%. Da es aber dem einen Patienten, der vor uns als Arzt sitzt, egal ist, ob er zu denen gehört, die nicht erkranken, oder zu denen gehört, die das Krankheitsrisiko Tod wirklich in sich tragen, interessiert ihn nicht die relative, sondern den Patienten interessiert die absolute Risikoreduktion.
Es hat sich im Rahmen der sog. Evidence-based Medicine in den letzten Jahren ein den Ansprüchen des Individuums nicht adäquater Denk- und Sprachstil eingeschlichen, der Sprachstil des relativen Risikos, der negiert, dass dies nicht das Problem der einen Person ist, die vor uns sitzt. Hier ist deswegen eine dringende Verbesserung klinischer Studien und vor allen Dingen der Interpretation klinischer Studien zu fordern.
Surrogatparameter
Letztlich bedeutet Ehrlichkeit aber auch, dass der Arzt im Umgang mit den Patienten nicht mit sog. Surrogatmarkern argumentieren kann. Z.B. ein erhöhtes Cholesterin oder ein erhöhter Zuckerwert ist erst einmal nur ein erhöhter und veränderter Laborwert. Dies ist nicht gleichzusetzen mit einer Erkrankung, wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod. Viele der Maßregeln und Empfehlungen, die durch Ärzte gegeben werden, beruhen aber auf diesen Surrogatparametern.
Manche der Empfehlungen, wie z.B. mediterrane Kost, beruht nicht nur auf Surrogatparametern, sondern sogar auch noch auf Beobachtungsstudien. Daher verletzen viele der Aussagen, die heute in der Sprechstunde getroffen werden, das ethisch begründete Recht des Einzelnen, in seiner Singularität betrachtet zu werden und mit ihm aufgeklärt zu diskutieren, warum eine bestimmte Therapieform oder eine bestimmte Therapieempfehlung gegeben wird.
Ethisches Dilemma: Guter Wille wird zu ärztlicher Hybris
Letztlich haben alle diese ethischen Dilemmata, denen sich die auf Surrogatparameter oder Beobachtungsstudien fundierte Medizin aussetzt, immer das gleiche Problem: Einerseits den guten Willen und Wunsch des Arztes, etwas Positives zu tun, andererseits das Fehlen von sauber durchgeführten Interventionsstudien, mit für den Patienten relevanten Endpunkten, und für den Patienten und den behandelnden Arzt relevanten Aussagen zur Wirksamkeit.
Dieses Gefühl des Arztes, durch Beobachtung und Surrogatparameter oder durch „gute“ Empfehlungen wie Sport, Gewichtsabnahme, oder mediterrane Kost das Schicksal des Einzelnen beeinflussen zu können, hat in seiner Konsequenz eine dramatische Verdrehung des guten Willens in eine ärztliche Hybris zur Folge. Es besteht in zunehmendem Maße die Gefahr, dass durch technische und biometrische Analysen der Arzt meint, die Zukunft vorhersagen zu können, das Schicksal erkennen zu können. Der Arzt hat sich wieder in eine „gottgleiche“ Person im weißen Kittel verwandelt.
Schon der Leibarzt Bismarcks sagte: „Die Wissenschaft behindert den Arzt am Arzten“. Was spricht aus einem solchen Satz? Es spricht aus einem solchen Satz letztlich die Erkenntnis, dass es nur die sauber durchgeführte, kritisch beleuchtete Wissenschaft ist, die den Arzt beschränkt und in seiner Beschränktheit dem Patienten gegenüber ehrlich argumentieren lässt. Was den Leibarzt Bismarcks störte, ist letztlich die Chance der Medizin: Durch Selbstbeschränkung Schaden vom Patienten fernzuhalten.
2. Der Arzt muss wissen, was er tut
Dies ist nur ein scheinbar banaler Satz, denn fragen Sie einmal Ihren Arzt über die Risikoreduktion eines blutzuckersenkenden Medikamentes oder eines Cholesterin-senkenden Medikamentes. Er wird Ihnen sagen, die Risikoreduktion beträgt 30 oder 40%. Aber, wie oben schon ausgeführt, ist dies nur die relative Risikoreduktion, nicht die absolute Risikoreduktion. Da in den meisten Studien nur ein Bruchteil der Patienten den Endpunkt tatsächlich erleidet, ist die absolute Risikoreduktion weitaus geringer.
- Ein Arzt, der weiß was er tut, würde also seinem Patienten nur über die absolute Risikoreduktion berichten. Er würde dem Patienten dann auch berichten können, ob der Endpunkt (z.B. Tod) nur um einige Tage verzögert wird oder um mehrere Jahre.
- Der Arzt, der weiß was er tut, würde präzise formulieren können, was die Charakteristika der Patienten sind, die trotz Therapie den Endpunkt (z.B. Tod) erleiden, d.h. er würde genau die Patienten erkennen können, die von der Therapie nicht profitieren.
- Der Arzt, der exakt weiß was er tut, würde nicht die Präzision der Statistik beurteilen, die bedeutet, dass möglichst viele Patienten in einer Studie einen möglichst guten Signifikanzwert ergeben, sondern er würde wissen, wie viele Menschen man behandeln muss, um dem einen für wie viele Monate oder Jahre zu helfen.
- Der Arzt, der weiß was er tut, würde deswegen seinen Patienten überzeugen können, nicht über die Nebenwirkungen zu sprechen, sondern über die tatsächlich zu erwartende Wirkung, deren Nebenwirkungen eingeschlossen sind.
Was Ihr Arzt nicht wissen kann
Doch so wie Studien typischerweise ausgewertet werden, sind das genau die Parameter, die Ihnen Ihr Arzt nicht nennen kann.
- Es gibt fast keine Studie, in der die Patienten charakterisiert werden, die auf ein Medikament nicht ansprechen.
- Es gibt fast keine Studie, die das absolute Risiko erwähnt.
- Und es gibt nur sehr wenige Studien, die tatsächlich sagen, um wie viele Monate oder Jahre der untersuchte Endpunkt verzögert wird.
Das führt zu einer verwirrenden Diskussion – am Beispiel Cholesterin kennt man, dass die einen von „Cholesterinlüge“ sprechen, die anderen sagen, jeder braucht einen Cholesterinsenker – die Wahrheit liegt hier in der Mitte: Je höher das Risiko, desto wirksamer die Medikation.
Aber durch die schlechten Studien bzw. durch die schlechte Auswertung, die im Rahmen der Evidence-based Medicine für die Zulassung der Präparate und die Bewerbung der Präparate üblich geworden ist, kann der Arzt nur selten eine bessere Auskunft geben.
Gestörte Arzt-Patienten-Kommunikation durch Lücken der Wissenschaft
Eine solchermaßen schlechte Studienlage erklärt zwanglos, warum es zu solchen Missverständnissen kommt, und warum die Arzt-Patienten-Kommunikation in einem hohen Maße gestört wird. Die fehlende Wissenschaftlichkeit und das Unwissen beschränken den Arzt in seinem Selbstverständnis, so dass er nicht überzeugend mit seinem Patienten kommunizieren kann.
Letztlich steht fest: Wissenschaft schränkt ein, deswegen kann Medizin nie ganzheitlich sein. Ein Arzt mit seiner Wissenschaft kann nie den ganzen Menschen erkennen. Der Arzt muss bescheiden werden, die Wissenschaft hält ihn am Boden.
Und die Wissenschaft ist es, die angesichts der Lücken der Medizin, dem Mediziner und der Medizin als Fach, deutlich macht, dass sie nie alleine bestehen kann, sondern immer andere Fächer wie z.B. Philosophie oder Theologie braucht, um einem Menschen gerecht zu werden.
3. Der Arzt soll sich klar sein, dass Lebenskunst wichtig und individuell ist.
Schaut man sich, das ist auch der Versuch im Buch „Gesundheitsdiktatur“, genau an, was wir an Interventionen bei gesunden Menschen erfolgreich empfehlen können, bleibt enorm wenig übrig. Gerade bei Kranken, wo wir Erfolge erzielen können, versagt die Wissenschaft sehr oft in der Darstellung der Zahlen, die der Patient und der Arzt beide benötigen. Jedoch gibt es gute und fundierte Therapien.
Aber bei Gesunden ist einfach nicht die Medizin gefragt – bei Gesunden ist die Lebenskunst gefragt, der optimale Mittelweg, den jeder wählen muss, um unter den Bedingungen, denen er ausgesetzt ist, ein möglichst glückliches Leben zu führen. Der Arzt soll sich klar sein, dass Lebenskunst individuell ist und wichtiger als „an appel a day, keeps the doctor away“. Dass dies ein vernünftiger Ratschlag ist, wusste nicht nur Hippokrates, es wusste nicht nur Plato, der sein eigenes Konzept einer gesunden Diät hatte, sondern dies zeigen auch sehr präzise durchgeführte moderne Studien.
Fett macht glücklich, gutes soziales Umfeld auch
So konnte man z.B. nachweisen, dass Menschen, die einen traurigen Film schauen, ihn nur halb so traurig finden, wenn sie Fett im Bauch haben. Das bedeutet, dass es eine biochemisch sehr gut untersuchte Achse zwischen Fettverdauung einerseits und psychischem Erleben andererseits gibt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass gerade Menschen, die arm sind, die isoliert sind, die sozial benachteiligt sind, das größte Problem mit Übergewicht und Adipositas haben.
So zeigte auch eine wunderbar durchgeführte Interventionsstudie aus den USA (auch dies ist in meinem Buch ausführlich erklärt), dass wenn man Menschen nicht Ernährungsberatung gibt, sondern ihnen die Möglichkeit schenkt, in ein Umfeld zu ziehen, wo sie sich wohler fühlen, dass allein dieser Umzug schon ausreicht, um das Risiko für Zivilisationserkrankungen zu senken.
Fazit
Was ergibt sich zusammenfassend aus diesen drei Wünschen, die auf dem „Bierdeckel“ dann formuliert werden? Es ergibt sich daraus:
- Der Ansatz einer Selbstbegrenzung der Medizin,
- der Aufruf zur Interdisziplinarität innerhalb der Medizin,
- der Aufruf, Studien so zu beschreiben und auszuwerten, dass die erzielten Daten nicht nur der Zulassung dienen, sondern auch dem Arzt und dem Patienten die Zahlen liefern, die sie brauchen, um miteinander zu sprechen.
- Letztlich ergibt sich daraus der Aufruf zu einer menschenzugewandten, in sich aber bescheidenen Medizin, die sich vor allen Dingen um Kranke, nicht um Gesunde kümmert.
Auch wenn politisch anders gewollt, so zeigt doch die nüchterne Studienlage, dass Prävention nur bei denen funktioniert, die die Prävention eigentlich nicht brauchen. Wer privilegiert ist, ist gesünder – auf die, die nicht privilegiert sind und deswegen sich selber schädigen, um in unserer Gesellschaft überleben zu können, mit dem Finger zu zeigen, ist deswegen unmenschlich.
Über den Autor
 Prof. Dr. Peter Nawroth, geboren 1954, forschte nach seinem Medizinstudium in Hamburg 5 Jahre lang in New York und Oklahoma. Seine Facharztausbildung in Innerer Medizin und die Habilitation schloss er in Heidelberg ab. Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Diabetologie, Gefäßerkrankungen, Hormon- und Stoffwechselstörungen. Seit 2006 ist Nawroth an der Universität Heidelberg Direktor der Abteilung Innere Medizin I (Endokrinologie und Stoffwechsel, mit Sektion Osteologie, Sektion Nephrologie) und Klinische Chemie. Hier leitet er Europas größten Sonderforschungsbereich zu Diabetischen Spätschäden. Fachwelt und Medien schätzen Prof. Nawroth wegen seiner kritischen Analyse und seines Einsatzes für eine humane, Wissenschafts-basierte Medizin.
Prof. Dr. Peter Nawroth, geboren 1954, forschte nach seinem Medizinstudium in Hamburg 5 Jahre lang in New York und Oklahoma. Seine Facharztausbildung in Innerer Medizin und die Habilitation schloss er in Heidelberg ab. Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Diabetologie, Gefäßerkrankungen, Hormon- und Stoffwechselstörungen. Seit 2006 ist Nawroth an der Universität Heidelberg Direktor der Abteilung Innere Medizin I (Endokrinologie und Stoffwechsel, mit Sektion Osteologie, Sektion Nephrologie) und Klinische Chemie. Hier leitet er Europas größten Sonderforschungsbereich zu Diabetischen Spätschäden. Fachwelt und Medien schätzen Prof. Nawroth wegen seiner kritischen Analyse und seines Einsatzes für eine humane, Wissenschafts-basierte Medizin.
Kontakt
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Nawroth
Direktor Innere Medizin I und Klinische Chemie
Im Neuenheimer Feld 410
69120 Heidelberg
Sekretariat Tel.: +49 6221 56-8601
Fax.: +49 6221 56-5587
http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Willkommen.879.0.html
Buchempfehlung von der Redaktion
Die Gesundheitsdiktatur
Weshalb uns Medizin und Industrie einen Lebensstil empfehlen, der nicht hält, was er verspricht.
 Dieses Buch meines Kollegen Prof. Dr. Peter Nawroth hat mich überwältigt. Sowohl durch die Menge an Text und Informationen als durch die Tatsache, dass ein noch aktiver Ordinarius sich an unserer Heidelberger Universität so weit aus dem Fenster lehnt und die Schwächen der Evidence-based-Medicine, eine eher heilige Kuh der Universitätsmedizin, vorführt.
Dieses Buch meines Kollegen Prof. Dr. Peter Nawroth hat mich überwältigt. Sowohl durch die Menge an Text und Informationen als durch die Tatsache, dass ein noch aktiver Ordinarius sich an unserer Heidelberger Universität so weit aus dem Fenster lehnt und die Schwächen der Evidence-based-Medicine, eine eher heilige Kuh der Universitätsmedizin, vorführt.
Oder würden Sie erwarten, dass ein Endokrinologe und Labormediziner so weit gehen und sagen würde: „Wir müssen den Menschen als Ganzes sehen und sollten keine Laborwerte behandeln“? Hier schreibt ein Professor, der zugibt, wie wenig wir vom Menschen in seiner Gesamtheit verstehen und wie selten wir in der Praxis verwertbare Schlüsse aus teuren Studien ziehen können.
Während meines Studiums gab es noch vereinzelt Professoren, die einen großen Namen als Ärzte und Humanisten hatten. Mit Professor Nawroth gibt es endlich wieder einen, der statt Diäten Lebenskunst propagiert, der auf Selbstbestimmung und Individualität setzt und das mehr Philosophische in der Medizin betont. Dieses Buch „Gesundheitsdiktatur“ ist allen informierten Laien zu empfehlen, die ihrem Arzt die richtigen Fragen stellen und ihre Therapien mitbestimmen wollen. Für alle Ärzte und die meisten im Gesundheitssystem tätigen Menschen ist es sowieso ein „Muss“.
Und welche Erfahrungen haben Sie mit Ihren Ärzten gemacht? Wollen Sie die Wünsche ergänzen? Dann schreiben Sie doch einen Kommentar!







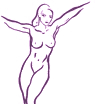 Netzwerk Frauengesundheit
Netzwerk Frauengesundheit





Liebe Ingrid, lieber Herr Professor Nawroth,
von Herzen bedanke ich mich für diesen intelligenten und differenzierten Beitrag. Er ist das Hilfreichste, was ich seit Langem über Statistiken und ihre Aussagekraft gelesen habe. Knackig und präzise wird das Wesentliche auf den Punkt gebracht. Ich werde meinen Patient*innen die Lektüre wärmstens empfehlen.
Ich selbst habe sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Ärzt*innen gemacht. Es gibt sehr tiefgründige und einfühlsame Menschen unter ihnen. Und es gibt dem Zeitdruck und manchmal auch der Arroganz geschuldete Oberflächlichkeit.
Den Patient*innen bleibt es nicht erspart, sich ihren Begleiter in Sachen Gesundheit wohlüberlegt auszusuchen und selbst tief zu schürfen, wenn sie eine ernsthafte Erkrankung erleiden.
Vor vielen Jahren habe ich mir als selbst Betroffene tatsächlich die Mühe gemacht, das Internet nach Studien zu bestimmten Medikamenten zu durchforsten und diese im Detail zu analysieren. Schon allein das Studiendesign ist teilweise haarsträubend.
Fragen Sie ruhig Ihre Ärzt*innen detailliert nach den Studien, wenn sie mithilfe von pauschalen Aussagen zum angeblichen Nutzen einer bestimmten Therapie Druck auf Sie ausüben wollen. Ich vermute: Sie werden überrascht sein…
Vielleicht kann ich in Sachen individuelle Lebensgestaltung etwas ergänzen durch meinen BlogBeitrag https://praxis-lichtblick.eu/hauptsache-gesund-die-illusion-vom-ewigen-leben/
Herzliche Grüße,
PetRa Weiß
Liebe PetRa,
danke für Deinen verständnisvollen und fundierten Kommentar. Hier noch ein Artikel, der vielleicht zu Deinem Blogbeitrag passt: „Ach wenn ich doch unsterblich wäre“ Liebe Grüße
Sehr geehrte Frau Weiß, liebe Frau Gerhard,
Sie ahnen ja gar nicht, wie ich mich über diese positive Kritik freute, denn Sie wissen nicht, wie ich manchmal auch angefeindet werde, bis hin zu Anmerkungen von eigenen Mitarbeitern, ich würde durch dieses Engagement ihre Karriere gefährden. Aber dass nicht alle so denken, tut gut, mein leitender Oberarzt wurde jetzt auch als ständiges Mitglied in die Arzneimittelkommission berufen, also ganz langsam bewegt sich vielleicht doch etwas, man darf nur nicht aufhören sich zu engagieren.
Es ist ja mein Traum, dass daraus langsam eine Bewegung entsteht, die nicht nachfragt was die optimale Statistik ist, sondern ob mit den üblichen Werkzeugen es nicht möglich sein solle, besser das herauszuarbeiten, was für den Patienten wichtig und relevant ist. Wenn wir Ärzte uns aus der Diskussion raushalten und dieses Engagement aufgeben, dann haben wir unsere Aufgabe verfehlt. Deswegen organisiere ich am 7. und 8. Februar 2019 ein Symposium, das sich nicht nur an Ärzte richtet, sondern auch Journalisten und andere Interessierte, die bereit sind, nachzudenken und mitzuwirken, dass wir eine andere Ausrichtung der Medizin bekommen. Ich versuche dabei mehrere kritische Köpfe zusammenzubekommen, zur gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit zu bwegen, denn bisher agieren Frau Mühlhauser oder Herr Antes, beide kommen, nur alleine und es gibt keinen richtigen Verbund.
Falls es Sie interessiert, geben Sie mir doch Ihre Anschrift und wir senden Ihnen das Programm,
Ihr
Peter Nawroth